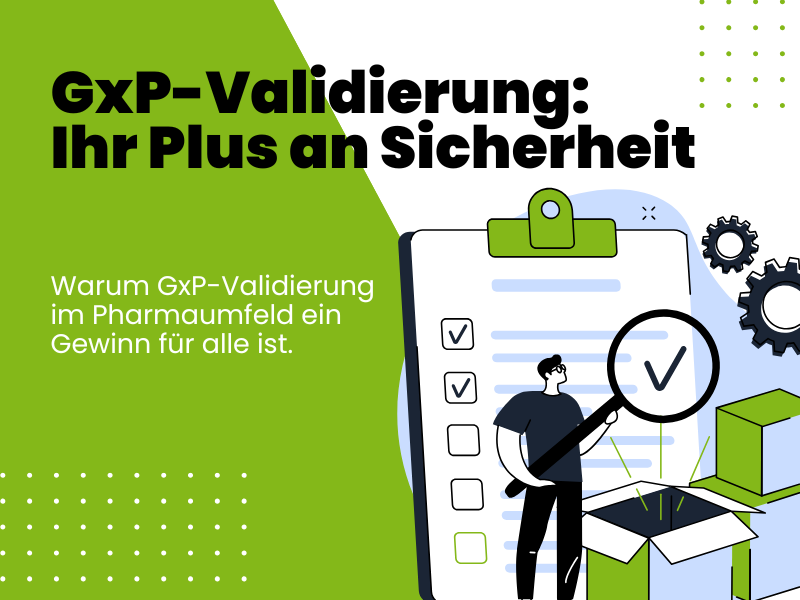Validierung tut nicht weh
– Warum GxP-Validierung im Pharmaumfeld ein Gewinn ist
Im pharmazeutischen Umfeld gehört Validierung zum Alltag – und doch löst sie regelmäßig Unbehagen aus. Wer mit GxP-Anforderungen arbeitet, weiß: Die Validierung von Prozessen, Systemen oder Anlagen ist kein „Kann“, sondern ein „Muss“.
Doch was wäre, wenn wir das Narrativ drehen? Validierung ist kein bürokratisches Monster. Sie ist ein Werkzeug für Sicherheit, Qualität und Vertrauen. Und sie tut nicht weh – wenn man sie richtig versteht und angeht.
Was bedeutet Validierung im GxP-Umfeld?
Validierung bedeutet im pharmazeutischen und medizinisch-regulierten Bereich, dass ein Prozess, Verfahren, System oder Gerät nachweislich das tut, was es tun soll – verlässlich, reproduzierbar und dokumentiert.
Dabei unterliegt alles, was Einfluss auf Produktqualität, Patientensicherheit oder Datenintegrität hat, den GxP-Regularien (Good Manufacturing Practice – GMP, Good Laboratory Practice – GLP, Good Clinical Practice – GCP). Besonders relevant sind:
- Prozessvalidierung: Funktioniert der Herstellprozess zuverlässig unter Routinebedingungen?
- Reinigungsvalidierung: Werden Kreuzkontaminationen sicher vermieden?
- Computersystemvalidierung (CSV): Arbeiten IT-Systeme im GxP-relevanten Umfeld sicher und nachvollziehbar?
- Transport- und Lagerbedingungen: Werden stabile Temperaturen und Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet?
Validierung ist also der Beweis, dass die eingesetzten Mittel – von Maschinen über Software bis zu Prozessen – geeignet und kontrolliert sind.
Warum die Validierung oft als lästig empfunden wird
Obwohl ihre Bedeutung unbestritten ist, haftet der Validierung oft ein negatives Image an. Gründe dafür sind:
- Zeit- und Ressourcenaufwand
Dokumentation, Testpläne, Qualifizierungsprotokolle – all das bindet personelle und zeitliche Ressourcen. - Komplexität der regulatorischen Anforderungen
Die Vielzahl an Regularien (EU-GMP, FDA 21 CFR Part 11, Annex 11, ICH Q8–Q10 usw.) ist für viele schwer überschaubar. - Fehlende Integration im Alltag
Oft wird Validierung als Zusatzaufgabe betrachtet, nicht als integrierter Bestandteil des Lebenszyklusmanagements. - Angst vor Auditabweichungen
Die Sorge, dass ein Prüfer eine Lücke findet, erzeugt Druck – besonders bei CSV und qualitätskritischen Prozessen.
Doch hier lohnt sich ein Perspektivwechsel.
Validierung als Schutzschild – und strategischer Vorteil
Validierung ist kein Selbstzweck. Sie ist das, was zwischen einem „vielleicht funktioniert’s“ und einem „nachgewiesen sicher“ steht. Richtig angewendet bietet sie viele Vorteile:
- Sicherheit für Patienten und Produkte
Validierung stellt sicher, dass Medikamente unter kontrollierten Bedingungen hergestellt werden – reproduzierbar und sicher. Jeder Schritt ist nachvollziehbar dokumentiert – von der Entwicklung bis zur Auslieferung.
- Risikominimierung für das Unternehmen
Fehlerhafte Chargen, Rückrufe oder Datenverluste kosten Geld – und Reputation. Validierung reduziert diese Risiken erheblich.
- Audit-Readiness und Compliance
Eine gut dokumentierte, risikobasierte Validierung hält internen und externen Audits stand – sei es durch die FDA, EMA oder Kundenaudits.
- Vertrauen und Transparenz
Validierung schafft Vertrauen – bei Kunden, Partnern, Behörden und auch intern. Sie zeigt: Wir arbeiten kontrolliert, nachvollziehbar und qualitätsbewusst.
So gelingt Validierung praxisnah und effizient
Validierung muss kein überdimensioniertes Projekt sein. Wer strukturiert und mit Augenmaß vorgeht, kann sie effektiv in bestehende Prozesse integrieren:
- Risikobasierter Ansatz (nach ICH Q9)
Nicht alles ist kritisch – und nicht alles muss gleich stark validiert werden. Risikoanalysen (z. B. FMEA) helfen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen.
- Lifecycle-orientierte Planung
Validierung beginnt nicht erst kurz vor dem Go-Live – sondern idealerweise mit der Anforderungserhebung (User Requirements Specification – URS) und begleitet das System durch seinen gesamten Lebenszyklus.
- Standardisierung und Automatisierung
Templates, Checklisten und digitale Validierungswerkzeuge sparen Zeit und fördern Konsistenz.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
QA, IT, Engineering, Produktion und Fachabteilung sollten als Partner agieren – nicht als Gegner. Gute Kommunikation vermeidet Missverständnisse und unnötigen Mehraufwand.
Fazit: Validierung tut nicht weh – wenn man sie versteht
Die Angst vor der Validierung ist oft unbegründet. Denn sie ist kein Kontrollinstrument gegen die Mitarbeitenden – sondern ein Schutzmechanismus für Patienten, Unternehmen und Prozesse.
Wer Validierung frühzeitig, risikobasiert und praxisnah in seine Arbeitsabläufe integriert, wird feststellen:
✅ Sie bringt Struktur.
✅ Sie erhöht die Qualität.
✅ Sie reduziert Risiken.
✅ Und sie schafft Vertrauen – nach innen und außen.
Validierung tut nicht weh. Sie wirkt – wenn man sie richtig anwendet.